Unwetter
Die erste Geschichte, die ich je schrieb.
Wieder hervorgekramt, weil ich den Regen, den Sturm, das Unwetter draußen gerade unwahrscheinlich herbeisehne, damit es meine innere Unruhe einfach wegspült …
Unwetter
Es regnet. Nein, es stürmt. Nein, es ist ein riesiges Unwetter, welches sich gerade genau über meinem Stadtteil austobt. Der Regen peitscht gegen mein Fenster, so heftig, dass man Angst haben muss, dass die Scheiben zerbrechen. Doch sie halten stand. Der Wind reißt an den Bäumen, die so im Licht der Laterne unheimliche Schatten werfen, die sich bewegen. Nachdenklich schaue ich aus dem Fenster und schaue dem Naturschauspiel eine Weile zu. Ich bin etwas verwirrt, denn mein Körper möchte die Kraft dieses Unwetters spüren.
Ich bin sonst eigentlich nicht der Mensch, der bei solchem Wetter einen Fuß vor die Tür setzt. Doch heute zieht es mich nach draußen, irgendetwas ruft nach mir. Also werfe ich mir, ohne lange zu überlegen, meinen Mantel über und verlasse die Wohnung. Vor der Haustür bleibe ich stehen, sie fällt hinter mir ins Schloss. Wohin sollte ich nun gehen? Es ist mitten in der Nacht, es gießt in Strömen und der Wind peitscht mir schmerzhaft den Regen ins Gesicht. Ich genieße diesen Schmerz, der mich jeglichen anderen vergessen lässt. Ich trete vollends in den strömenden Regen und schaue nach links und rechts. Verlassen und einsam liegt die Straße da, in einigen wenigen Fenstern brennt noch Licht oder flackert ein Fernseher. Es zieht mich Richtung Park, also laufe ich einfach los. Ich würde sehen, wo mein Weg mich hinführte.
Je näher ich meinem Lieblingsplatz komme, desto seltsamer fühle ich mich. Ich weiß nicht, wie ich dieses Empfinden definieren solle, aber ich fühle mich irgendwie gut damit. Ich schiebe alle Gedanken beiseite und konzentriere mich nur noch auf das Gefühl, das stärker in mir wird. Gerade, als mein Lieblingsplatz in meinem Blickfeld auftaucht, lenkt mein Körper unseren Weg in eine andere Richtung. Wo zur Hölle sollte mein Weg mich hinführen? Ich laufe und laufe, die Zeit nehme ich nicht mehr wahr, genauso wenig wie die Entfernung, die ich bereits zurückgelegt habe. Ich setze einfach einen Fuß vor den anderen und plötzlich fühle ich weichen Sand unter meinen Schuhen. Ich bin zum Strand gelaufen. Noch immer peitscht der Regen nieder, doch hier am Meer ist der Wind zu einem Sturm geworden. Er weht mir die Haare ins Gesicht und die Regentropfen treffen meine Haut wie Nadelspitzen.
Das Meer passt sich dem Sturm an und bäumt sich im Wind auf. Ich trete näher an das tobende Wasser und spüre, wie sich die schäumende Gischt mit dem Regen vermischt und mein Gesicht benetzt. Ich gebe meinem inneren Verlangen nach, schließe die Augen und streife meinen Mantel von meinen Schultern. Meine Kleidung ist bereits durchnässt und eigentlich sollte mir schrecklich kalt sein, doch ich spüre keine Kälte. Auch den Schmerz, den die nadelähnlichen Regentropfen in meinem Gesicht hinterlassen, nehme ich nicht mehr wahr. Stück für Stück entledige ich mich meiner Kleidung, die ich achtlos in den nassen Sand fallen lasse. Ich öffne meine Augen. Nackt stehe ich nun am Strand, doch es zieht mich weiter Richtung Wasser, in die Tiefen des Meeres. Ich gebe mich meinem Verlangen hin und wage einen weiteren Schritt, und noch einen, und noch einen.
Und plötzlich umspült mich das eiskalte Wasser des Meeres. Doch es reicht mir nicht, die Kälte in meinen Füßen zu spüren. Das Meer soll mich ganz haben. So schließe ich wieder die Augen, tauche Schritt für Schritt tiefer in das Wasser ein. Der Wind greift nach meinen Haare und weht sie durcheinander, die Gischt der Wellen, die gegen meinen Körper schlagen, vermischt sich weiter mit dem Regen und jagt mir weiterhin schmerzhafte Eissplitter auf die freiliegende nackte Haut. Mittlerweile stehe ich bis zum Brustansatz im Meereswasser, die Wellen brechen sich an meinen Schultern. Immer weiter zieht es mich vom Land weg, ins offene Meer hinein. Es fällt mir leicht, im Wasser zu gehen, wie schwebend gleite ich immer weiter. Ich höre, wie das Meer meinen Namen ruft, jedoch in einer für Menschen nicht verständlichen Sprache.
Ich drehe mich um und schaue zurück zum Strand. Er liegt ruhig da, meine Sachen wurden bereits vom Wasser weggespült. Nichts zeugt davon, dass ich hier bin. Ein Lächeln streift mein Gesicht, ich reiße meinen Blick vom Ufer los und laufe immer weiter in die Tiefe … bis die Wellen über meinem Kopf zusammenbrechen, ich den Regen nicht mehr auf meiner Haut spüre und mir der Wind nicht mehr um die Ohren pfeift.
Das Meer sollte mich ganz haben – Das Meer hat mich ganz …
(Oktober 2005)
Zurück zu:
bessere Tage! Weiter mit:
wie das Leben manchmal so spielt …
eine Kommentar



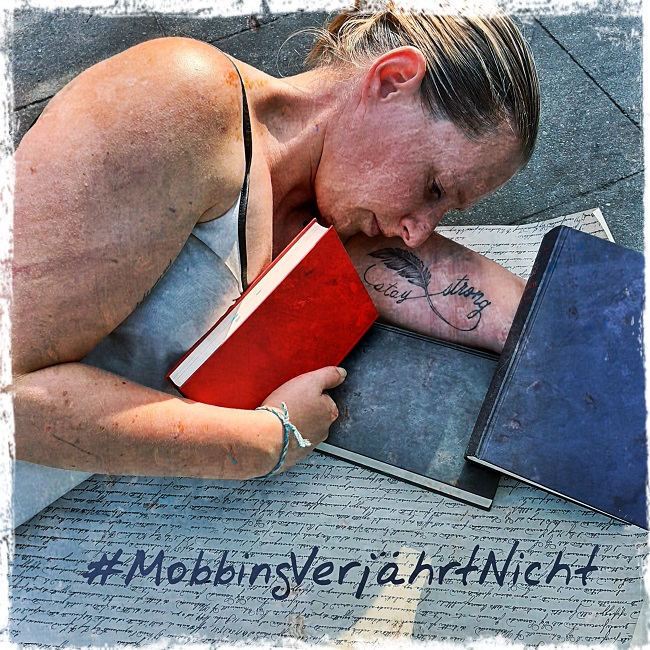
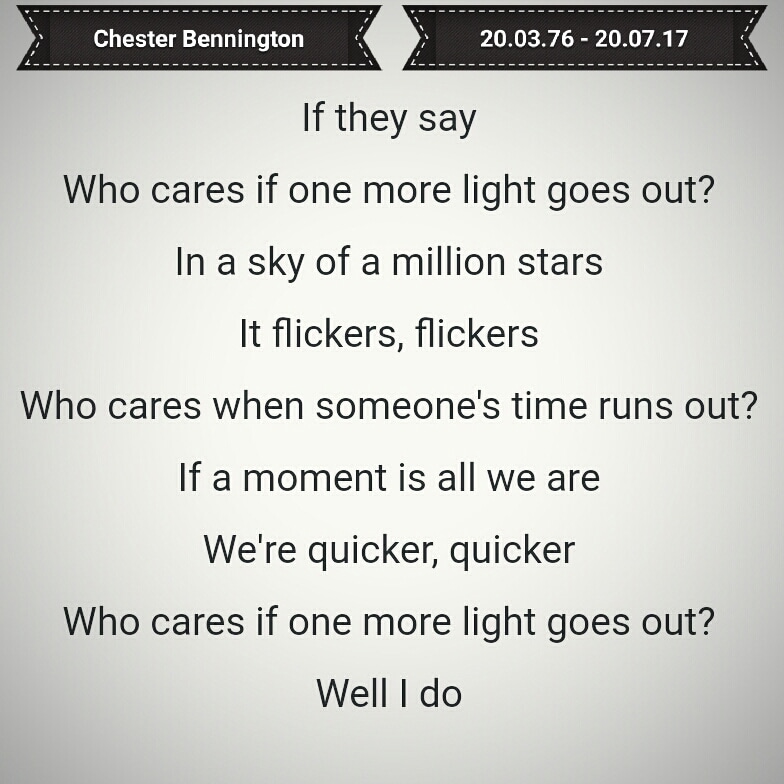
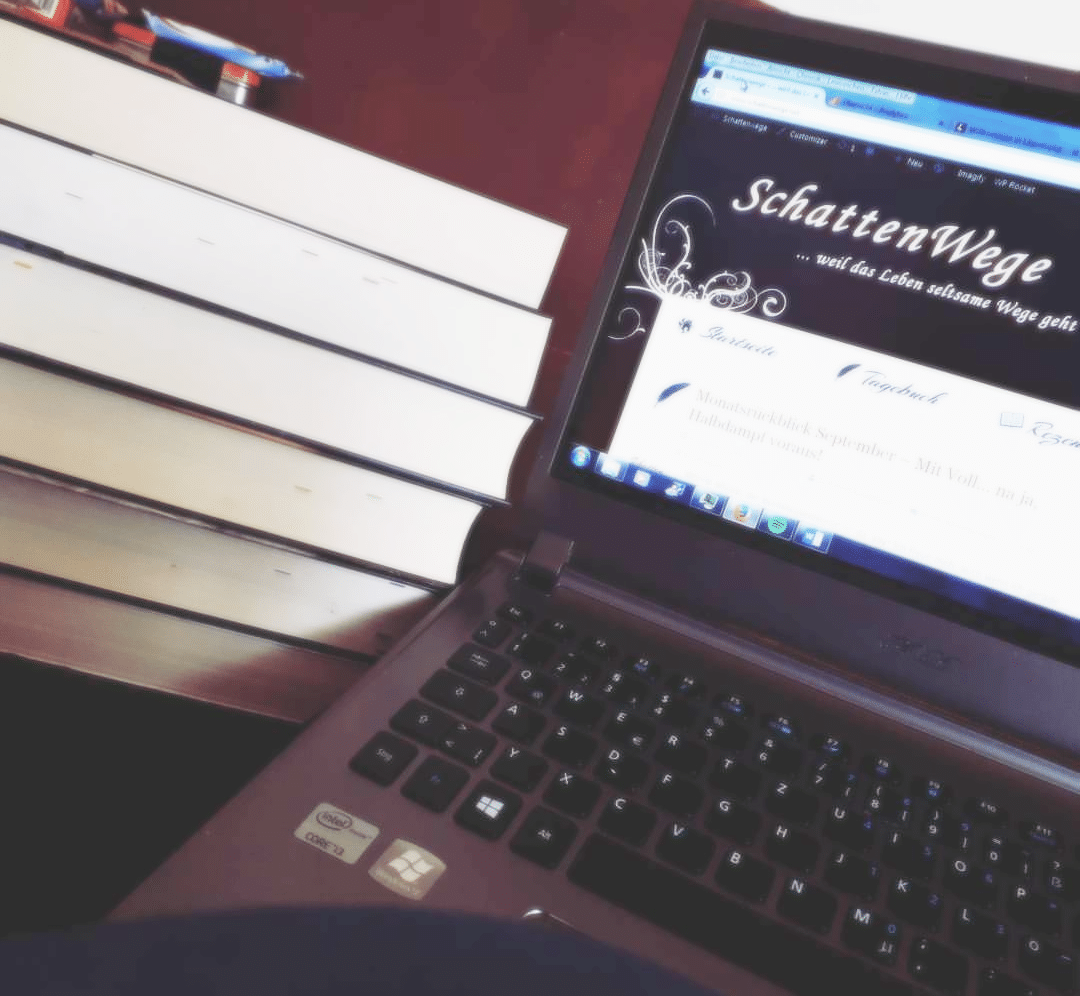
Für mich ist das Meer in der Nacht so schon reißerisch und unheimlich genug – aber dann noch mitten in einer sehr stürmischen Nacht erschauere ich schon allein beim Gedanken daran. Deine Geschichte ist sehr interessant. Ich habe eine Ähnliche geschrieben, vor ungefähr 15 jahren. Nur, dass es ein Liebespaar war, das sich entschied, so Abschied zu nehmen. Gemeinsam.
Eine schöne Geschichte. Du solltest mehr schreiben.